Sachverständigenbüro Oliveira
Von der Handwerkskammer Region Stuttgart öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für das Installateur- und Heizungsbauerhandwerk
Die Leistungen im Überblick
Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Installateur- und Heizungsbauerhandwerk, übernimmt Joaquim Pinheiro de Oliveira folgende Aufgaben:
- Erstellung von Gerichtsgutachten
- Erstellung von Privatgutachten
- Erstellung von Schiedsgutachten
- selbständige Beweisverfahren
- mündliche Gutachten beim Ortstermin
- schriftliche Gutachten zur Beweissicherung
Weitere Leistungen:
- Beratende und überwachende Begleitung bei der Projektabwicklung zur Qualitätssicherung, bereits während der Planungs-, Angebotsphase, und während der Ausführungs- Abnahmephase
- gutachterliche Bewertung von Angeboten
- gutachterliche Bewertung von Handwerkerrechnungen
- gutachterliche Beratung von Eigentümergemeinschaften
- Beratung für Betreiber zur hygienischen und technischen Beurteilung von Trinkwasseranlagen und technische Maßnahmen
- Durchführung von Hygiene-Erstinspektionen nach VDI/DVGW 6023 z.B. bei Trinkwasser- Neuinstallationen
- Erstellung von Risikoabschätzungen (ehemals Gefährdungsanalyse) bei Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes für Legionellen nach §51 der TrinkwasserV.
- Bewertung von Instandhaltungsmaßnahmen
- Schadens- Ursachenbegutachtung für das Gewerk Sanitär bei Wasserschäden inkl. Begleitung der Sanierungsarbeiten sowie der Angebots- und Rechnungsprüfung.
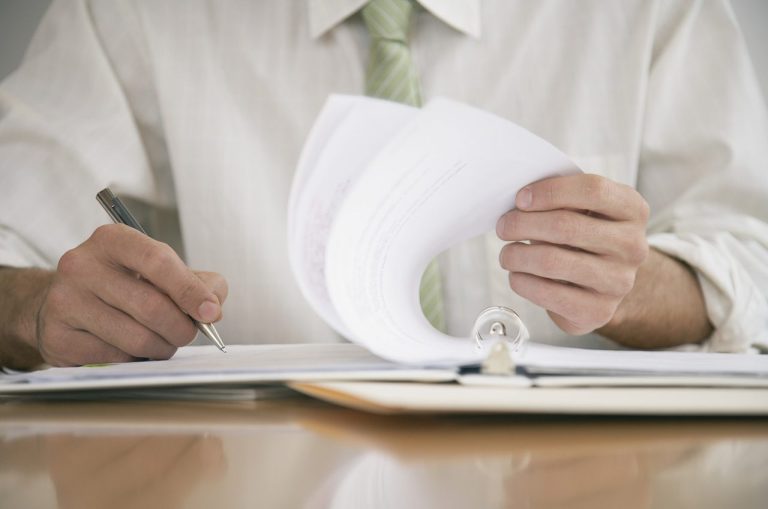
Gutachtenerstellung

Beratung

Risikoabschätzung
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständiger und seine Aufgaben
Grundlegendes:
Wer in der Bundesrepublik Deutschland als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger tätig sein möchte, muss seine Fähigkeiten einer Sachkundeprüfung unterziehen. Diese Prüfung findet im Handwerk durch die Handwerkskammern statt.
Ausschlaggebend für eine öffentliche Bestellung und Vereidigung, sind neben den persönlichen Kompetenzen auch überdurchschnittliche Fachkenntnisse in dem Bestellungsgebiet nachzuweisen. Diese überdurchschnittliche Qualifikation wird durch ein Fachgremium im Zuge von schriftlichen und mündlichen Prüfungen, sowie der Erstattung eines Mustergutachtens festgestellt. Nicht nur die jahrelange Ausübung eines Berufs ist in diesem Zusammenhang ausreichend. sondern auch Faktoren wie die Mitgliedschaft in Norm- und Prüfungsausschüssen, Veröffentlichungen, bis hin zur Reputation in der Branche werden ebenso berücksichtigt.
Öffentlich bestellte Sachverständige sind darauf vereidigt, alle Leistungen unabhängig, weisungsfrei und gewissenhaft zu erbringen.
Was bedeutet unabhängig, weisungsfrei und gewissenhaft in diesem Zusammenhang?
Die drei Begriffe der Unabhängigkeit, der Weisungsfreiheit und der Gewissenhaftigkeit beschreiben die Unparteilichkeit von Sachverständigen.
- Unabhängigkeit
Unabhängigkeit bedeutet, dass die Ersteller eines Gutachtens unter keinen Einflüssen stehen darf, die die Glaubwürdigkeit der angestellten Aussagen beeinflussen. - Weisungsfreiheit
Leistungen gelten dann weisungsfrei, wenn sie keinen vertraglichen Verpflichtungen unterliegen, die eine Feststellung und Bewertung von Sachverhalten beeinflussen. - Gewissenhaftigkeit
Die Erbringer:in der Leistung muss gewissenhaft überprüfen, ob die zu untersuchende Angelegenheit innerhalb des Sachgebiets liegt, für das die Gutachter:in bestellt wurde.
Aufgrund dieser Unparteilichkeit und nachgewiesener überdurchschnittlicher Fachkenntnis, werden öffentlich bestellte Sachverständige häufig von Gerichten zur Feststellung von Sachverhalten herangezogen. Anders als bei privaten Auftraggebern, wo sie die Erstellung eines Gutachtens ablehnen könnten, haben Sachverständige der gerichtlichen Ernennung stets Folge zu leisten, sofern keine ernstzunehmende Gründe dagegen sprechen.
Die Gutachtenarten im Überblick
Privatgutachten
Privatgutachten werden in der Regel von einer Partei bei Unsicherheit über die ordnungsgemäße Ausführung einer vereinbarten Leistung in Auftrag gegeben. Mit dem Privatgutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erhält der Auftraggeber die Entscheidungsgrundlage, ob ggf. ein Gerichtsprozess erfolgreich sein kann.
Ein Privatgutachten kann auch bei einer Beratung durch einen Rechtsanwalt diesem für die Erfassung der Sachlage dienlich sein, damit er schon im Vorfeld eines eventuellen Gerichtsverfahrens die Erfolgsaussichten und Risiken einschätzen und seinen Mandanten entsprechend beraten kann.
Mit dem Ergebnis eines Privatgutachtens ist es häufig dem anwaltlichen Vertreter einer Partei erst möglich, in einem Gerichtsprozess die baufachliche bzw. bautechnische Situation plausibel darzustellen und dem zuständigen, oft nicht sachkundigen Richter den Sach- und Schadensstand zu erläutern. Durch die Qualifikation des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen und dessen schriftlicher Darstellung des Sachverhalts in einem Gutachten kann unter Umständen auch eine unschlüssige Darstellung in den Schriftsätzen vermieden werden, die zum Nachteil in einem Gerichtsprozess führen könnte.
Das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wird in der Regel das Gericht davon überzeugen, sich weiter mit der Sach- und Rechtslage des streitigen Falles auseinander zu setzen und das Verfahren in die Beweisaufnahme zu überführen.
Kostenerstattung bei Privatgutachten
Auch wenn der Auftraggeber mit der ausgeführten Leistung eines Handwerksbetriebes nicht zufrieden ist, bestehen oft Bedenken gegenüber den Kosten und Folgen eines Gerichtsprozesses. Gerade bei der Frage nach der Kostenerstattung eines Privatgutachtens im Rahmen eines Gerichtsprozesses besteht Unsicherheit.
Wenn der Rechtsstreit gewonnen wird, werden auch häufig die Kosten für ein zuvor außergerichtlich beauftragtes Gutachten als für den Prozess notwendige Kosten anerkannt und im Rahmen der Kostenerstattung gegen den Gegner festgesetzt.
In § 91 Abs. 1 ZPO wird diese Frage beantwortet. Danach muss die unterlegene Partei die Kosten des Rechtsstreits tragen. Diese Kosten müssen jedoch zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen sein.
Ein Privatgutachten wird in der Regel dann als erstattungsfähig angesehen, wenn eine ausreichende Klagegrundlage nur durch einen Sachverständigen beschafft werden konnte, das Gutachten also für eine Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig war.
Gerichtsgutachten
Merkmale des Gerichtsgutachtens
Beweisbeschluss
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige erhält den gerichtlichen Auftrag, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ein Gutachten zu erstatten, dadurch, dass er mit einem kurzen Anschreiben die Gerichtsakte zugeschickt bekommt. Das Thema des von ihm zu erstattenden Gutachtens findet er im Beweisbeschluss. An diesen Beweisbeschluss des Gerichtes hat er sich auch in den Formulierungen strengstens zu halten.
Aktenstudium
Das Aktenstudium ist zur Vorbereitung des Gutachtens notwendig, um den bisherigen Prozessablauf beurteilen zu können. Zum Aktenstudium gehört in Vorbereitung auf den Ortstermin unter Berücksichtigung der Gerichtsakte auch das Studium entsprechender Fachliteratur, DIN-Normen, Veröffentlichungen etc., um während des Ortstermins alle relevanten Beurteilungskriterien erfassen zu können. Wichtig zu Beginn des Aktenstudiums ist zunächst auch die Beurteilung des angeforderten Kostenvorschusses. Wenn dieser nach Auffassung des Sachverständigen nicht ausreichend ist, um die voraussichtlichen Gutachtenkosten zu decken, muss der Sachverständige das Gericht darüber informieren, bevor er weitere Schritte unternimmt.
Ortstermin
Der Sachverständige setzt den Ortstermin mit einer ausreichenden Frist fest und lädt die Prozessparteien und deren Rechtsanwälte zur Ortsbesichtigung. Benötigt der Sachverständige von den Prozessparteien Unterlagen, die für den Ortstermin und auch für die spätere Ausarbeitung des Gutachtens relevant sind, kann er das Gericht bitten, diese anzufordern. Wenn die Parteien ordnungsgemäß zum Ortstermin geladen worden sind, kann der Ortstermin durchgeführt werden, selbst wenn eine der Parteien nicht erscheint. Dieser Umstand sollte jedoch aus rechtlichen Gründen im Gutachten deutlich vermerkt werden. Wird dem Sachverständigen die Ortsbesichtigung verwehrt, hat er dem Gericht von der Verhinderung Mitteilung zu machen. Verläuft der Ortstermin nicht sachlich, d. h., kommt es zu Wortgefechten oder Handgreiflichkeiten zwischen den Parteien, hat der Sachverständige das Recht, den Ortstermin abzubrechen und ggf. alleine zu wiederholen, falls dies möglich ist. In seltenen Fällen reicht jedoch das schriftlich erstattete Gutachten zur Urteilsfindung nicht aus. Es kann dann vorkommen, dass ein Richter den Sachverständigen auffordert, sein Gutachten in der Verhandlung mündlich vorzutragen, zu begründen, zu erläutern oder zu ergänzen.
Vergleichsbereitschaft
Wenn der Sachverständige während der Gespräche der Parteien beim Ortstermin bemerkt, dass diese bereit wären, einen Vergleich auf der Basis seiner Feststellungen zu akzeptieren, kann er dem Gericht einen entsprechenden Hinweis geben. Eine Vergleichsbereitschaft der Parteien sollte er dem Gericht jedoch gesondert von seinem Gutachten mitteilen.
Verpflichtung zur Gutachtenerstattung
Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ist grundsätzlich verpflichtet, ein vom Gericht beauftragtes Gutachten seines Sachgebietes zu erstatten. Die Übernahme eines Gerichtsgutachtens kann nur in einigen wenigen Ausnahmefällen aus triftigen Gründen, z. B. dem der Befangenheit, abgelehnt werden. Die Erstattung eines Gutachtens muss in einer angemessenen Frist erfolgen.
Unparteiische Gutachtenerstattung
Die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Erstattung von Gutachten ist ein relevanter Punkt bei der Auswahl eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, der in der Öffentlichkeit durch seine Bestellung auch eine besondere Vertrauenswürdigkeit beweist. Die Unparteilichkeit bei der Gutachtenerstattung ist eine Hauptpflicht des Gutachters gerade auch bei der Erstattung von Gerichtsgutachten. Der Sachverständige hat diese Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und die von ihm angeforderten Gutachten unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten. Seine Gutachten sollen für alle Beteiligten,
die mit seinem Gutachten in einem Prozess befasst sind, den Sachverhalt objektiv und nachvollziehbar darstellen. Ein Gutachten ist absolut unabhängig von den Interessen des Auftraggebers zu erstatten. Der Sachverständige darf festgestellt Mängel an einem von ihm begutachteten Objekt grundsätzlich nicht selbst beheben.
Ordnungsgemäße Gutachtenerstattung
Der Sachverständige hat die Gutachten ordnungsgemäß zu erstatten. Voraussetzung dafür ist, dass er die neuesten wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse auf seinem Fachgebiet kennt und berücksichtigt. Ggf. hat er, wenn erforderlich, technische Vorrichtungen oder Messinstrumente, etc. einzusetzen. Für jedes Gutachten ist die eindeutige Festlegung des Auftrages für den Sachverständigen wichtig. Relevant dafür sind beim Gerichtsauftrag die Formulierungen im Beweisschluss. Der Sachverständige darf Hilfskräfte beschäftigen. Dies ist allerdings nur zur Vorbereitung des Gutachtens erlaubt und auch nur, wenn gewährleistet ist, dass er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann.
Schweigepflicht und Auskunftspflicht
Auf Grund der Stellung des Sachverständigen als Helfer des Richters ist es ihm untersagt, Kenntnisse, die er bei der Ausübung seiner Tätigkeit gewonnen hat, Dritten unbefugt mitzuteilen, zum Schaden anderer oder zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten. Diese Pflicht ist ausdrücklich in den Sachverständigenvorschriften der Handwerkskammern ausgeführt. Die Sachverständigenvorschriften der Kammern legen jedoch ausdrücklich eine Aufzeichnungs- und Auskunftspflicht gegenüber der bestellenden Körperschaft fest. So ist der Sachverständige verpflichtet, über jedes von ihm angeforderte Gutachten Aufzeichnungen zu machen, aus denen der Auftraggeber, der Gegenstand des Auftrages und die Daten der Auftragserteilung und Auftragserledigung zu ersehen sind. Darüber hinaus ist der Sachverständige verpflichtet, der Handwerkskammer auf Anforderung die zur Überwachung seiner Tätigkeit erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte zu erteilen. Die bestellende Kammer hat dadurch die Möglichkeit, sich regelmäßig davon zu überzeugen, dass der Sachverständige seiner Gutachterpflicht nachkommt und sich über die Art der Erstattung seiner Gutachten zu informieren.
Schiedsgutachten
Um die Gerichte zu entlasten und eine Einigung zweier Parteien über ein streitiges Objekt kurzfristig ohne Gerichtsverfahren zu ermöglichen, wurde vom Gesetzgeber das Schiedsgutachten eingeführt.
Vom außergerichtlichen Gutachten, dem Privatgutachten, unterscheidet sich das Schiedsgutachten lediglich darin, dass der Vertrag mit dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen mit beiden Parteien geschlossen wird.
Diese einigen sich im Vorfeld auf einen Sachverständigen und verpflichten sich in einem gemeinsamen Vertrag mit ihm, den Ergebnissen und Empfehlungen des Gutachtens Folge zu leisten. Dabei wird ausgeschlossen, dass die Partei, in deren Interesse das Ergebnis des Gutachtens nicht liegt, die Anerkennung verweigern kann. Die Auftraggeber haften gegenüber dem Sachverständigen als Gesamtschuldner für dessen Gebühren. Die Aufteilung der Kosten unter den Parteien bzw. eine Quotelung der Gebühren kann im Vorfeld festgelegt werden.
Wenn auf Vorschlag eines Schiedsgerichts ein Sachverständiger um die Erstattung eines Gutachtens gebeten wird, ist die Stellung des Sachverständigen in diesem Falle entsprechend der eines gerichtlich bestellten Sachverständigen. Ein Unterschied besteht lediglich darin, dass der Auftrag für die Erstattung des Gutachtens durch das Schiedsgericht im Auftrag der sich streitenden Parteien erteilt wird und somit diese für die Kosten haften.
Zweck des Schiedsgutachtens ist vor allem die Möglichkeit einer schnellen Einigung, um weitere Gerichts- und Anwaltskosten einzusparen.
Versicherungsgutachten
Das Versicherungsgutachten ist eine Form des Privatgutachtens.
Versicherungsgutachten werden bei Sach- oder Haftpflichtschäden entweder von der zuständigen Versicherung oder von Versicherten bzw. Geschädigten zur Ermittlung von Schadensursache und -höhe beauftragt.
Der Sachverständige kann bei einer Leistungspflicht der Versicherung Fragen bezüglich der fachgerechten Schadensbeseitigung und der hierfür anfallenden Kosten sowie des möglichen Minderwertes beantworten. Außerdem kann er mit der Überwachung der fachgerechten Schadensbeseitigung beauftragt werden.
Für die Klärung möglicher Ansprüche eines Versicherungsnehmers gegen die Versicherung oder bei unterschiedlichen Ansichten über die Schadenshöhe kann die Beauftragung des Sachverständigen mit einem Gegengutachten hilfreich sein. Hierbei müssen die Versicherungsgesellschaften in der Regel auch die Kosten des Gutachtens tragen.
Schwerpunkte der Gutachtenerstattung:
- Begutachtung und Plausibilitätsprüfung von Einbruchs-, Sach- und Haftpflichtschäden
- Schadensfeststellung, Schadensbewertung, Schadensdokumentation
- Schadenshergangsanalysen
Beratung
Es kommt oft vor, dass das Fachhandwerk oder Auftraggeber fachliche Beratung suchen. Bedingt durch die immer anspruchsvolleren Vorgaben der allgemein anerkannten Regeln der Technik, Verordnungen und Gesetze, kommt das Fachhandwerk oftmals bei einer kompliziert zu errichtenden Anlage an deren Grenzen. Dann suchen Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam eine technische Lösung. Auch hierbei kann ein Sachverständiger als Berater zur Seite stehen. Es geht in solchen Fällen nicht um Schuldzuweisungen, sondern lediglich darum, eine technisch effiziente Lösung zu finden, damit der Auftragnehmer seinen Soll erfüllt und der Auftraggeber seine beauftrage Leistung erhält.
Grundsätzlich gilt: Wenn ein Sachverständiger bereits in der Beratungsphase hinzugezogen wird oder spätestens dann, wenn technische Fragen oder Aufgaben nicht im ersten Anlauf selbst gelöst werden können, erspart man den Parteien oftmals eine Menge Ärger und Kosten. Es geht hierbei nicht nur um die Beratung und Begleitung der technische Planung, Ausführung und Abnahme, sondern auch um die Überprüfung der Kosten.
Die Praxis zeigt: Kommt es zu einer Reihe von Fehlversuchen, so sind die Fronten meist so sehr verhärtet, dass ein oft rein technischer Mangel zu einer dauerhaften Emotionalisierung der Vertragsparteien eskaliert und nur mit Anwälten und Gerichten unter Einbeziehung von Sachverständigen gelöst wird.
Unabhängig davon, ob Sie als Auftraggeber oder Auftragnehmer am Geschehen beteiligt sind, lassen Sie sich bei technischen Problemen frühzeitig von einem kompetenten und unabhängigen Fachmann beraten.
Der Sachverständige bezieht sich ausdrücklich auf seine öffentliche Bestellung und Vereidigung. So darf er nur Fragen beantworten, die in sein Bestellungsgebiet fallen. Eine allgemeine, gewerkeübergreifende Beratung am Bauhandwerk kann nicht gegeben werden.
Alle öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Risikoabschätzung (ehemals Gefährdungsanalyse) und
Hygiene-Erstinspektion
Risikoabschätzung
Wird in einer Trinkwasseranlage der technische Maßnahmenwert für Legionellen (100 KBE / 100 ml) erreicht oder überschritten, schreibt die Trinkwasserverordnung die Durchführung einer Risikoabschätzung (ehem. Gefährdungsanalyse) vor. Diese Risikoabschätzung zeigt den Weg zur Lösung des Hygieneproblems in der Trinkwasseranlage.
Dazu wird u. a folgendes durchgeführt:
- eine Prüfung der vorliegenden Dokumentation
- eine Ortsbesichtigung mit Bestandsaufnahme
- die Prüfung auf Einhaltung der allgemein anerkannte Regeln der Technik
- eine Bewertung vorhandener Analyseberichte von Probeentnahmen
- die festgestellten Mängel individuell bewertet
- Handlungsempfehlungen gegeben
Die Handlungsempfehlung zielt darauf ab, aufzuzeigen wie die Trinkwasseranlage wieder in einen Zustand gebracht werden kann, in dem eine Gefährdung der Gesundheit ihrer Nutzer nicht zu besorgen ist.
Die Risikoabschätzung (ehem. Gefährdungsanalyse) wird in Form eines Gutachtens dokumentiert.
Eine Gefährdungsanalyse muss „unabhängig von anderen Interessen erfolgen. Insbesondere muss eine Befangenheit ausgeschlossen werden. Eine Befangenheit ist dann zu vermuten, wenn Personen an der Planung, dem Bau oder Betrieb der Trinkwasser-Installation selbst beteiligt waren.
Aus der Trinkwasserverordnung ergibt sich also die Notwendigkeit diese Risikoabschätzung von z.B. einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchführen zu lasse.
Hygiene Erstinspektion
Ziel der Hygiene-Erstinspektion, einer Trinkwasseranlage nach VDI 6023 Blatt 1 ist es, vor Befüllung und Inbetriebnahme der Trinkwasseranlage festzustellen, dass sich diese in einem technisch einwandfreien Zustand befindet. Weiter müssen von der Planung bis zur Abnahme die vom Bauherr beauftragten Planer, Ingenieure, Hygieniker, Architekten, ausführenden Unternehmer und Lieferanten, ihre Pflichten als Sach- und Fachkundige erfüllen. Als oberster Grundsatz gilt: "Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist."
Durch eine Inspektion der Rohinstallation können mögliche Ursachen für spätere Mängel bereits vor der Befüllung und der Verdeckung der Trinkwasseranlage identifizieren werden. Schäden oder sogar späteren Gefährdungen der Nutzer können mit dieser Maßnahme frühzeitig gezielt entgegengewirkt werden. Nach VDI 6023 Blatt 3 ist die Hygiene-Erstinspektion eine Voraussetzung zur Befüllung einer neu errichteten Trinkwasseranlage und somit verpflichtend.
Planerische Mängel oder Fehler in der Installationen können zu diesem Zeitpunkt noch mit vergleichsweise geringem Aufwand beseitigt werden. Ist die Anlage erst einmal gefüllt und innerhalb von Wänden, Deckenverkleidungen oder Bodenaufbauten verdeckt, werden etwaige Mangelbeseitigung sehr schnell aufwändig und teuer.
Ein Auftraggeber kann jedoch nicht eine erkennbar mangelhafte oder fehlerhafte Ausführung der Arbeiten ungemeldet lassen, um einen Mangel dann erst im Rahmen der Abnahme zu melden um daraus eventuell eine Rechnungskürzung zu beabsichtigen. Wenn der Bauherr durch ordnungsgemäße Überwachung und Kontrolle den Schaden hätte vermeiden oder die Folgen hätte reduzieren können, trifft ihn unter Umständen eine Mitschuld, so dass der insgesamte Schaden nicht alleine vom Installateur zu tragen wäre. Die Hygiene-Erstinspektion ist daher nach den Vorgaben der VDI 6023 Blatt 3 vom Auftraggeber zur Überprüfung des hygienisch einwandfreien Zustands der Trinkwasseranlage zu beauftragen.
Diese Prüfung darf nur von fachkundigen Personen mit dem Nachweis hygienetechnischer Zusatzqualifikation, z. B. als Inhaber einer VDI-Urkunde "VDI 6023, Kategorie A" und/oder öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige mit dementsprechenden Bestellungsgebiet, durchgeführt werden.
Die Hygiene-Erstinspektion umfasst die Prüfung der Trinkwasseranlage auf Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen des erstellten Raumbuchs.
Im Rahmen der Hygiene-Erstinspektion festgestellte Mängel, z. B. erkennbare Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik, müssen vor dem Befüllen der Trinkwasser-Installation behoben werden. Die Revisionsunterlagen müssen ggf. angepasst werden.
Hygiene-Erstuntersuchung
Nach der Hygiene-Erstinspektion und der Beseitigung von Mängel, wenn welche aufgetreten sind, darf die Trinkwasseranlage ordnungsgemäß gespült, befüllt und in Betrieb genommen werden. Zum Nachweis einwandfreier Trinkwasserqualität muss unmittelbar nach der Befüllung an repräsentativen endständigen Stellen eine Kontrolle der Wasserbeschaffenheit erfolgen.
Dabei gilt zu beachten:
Welche Trinkwasseranlagen sind betroffen?
Großanlagen zur Trinkwassererwärmung die,
- einen Warmwasserspeicher mit mehr als 400 Liter Wasserspeichervermögen haben und Duschen vorhanden sind.
und/oder
- Rohrleitungsinhalt von mehr als 3 Litern, gemessen zwischen Abgang des Warmwasserspeichers und der entferntesten Entnahmestelle. (Hinweis: Der Inhalt der Zirkulationsleitung wird nicht dafür berücksichtigt)und
Somit sind praktisch alle Mehrfamilienhäuser betroffen.
Ein- und Zweifamilienhäuser sind keine Großanlagen gemäß der Trinkwasserverordnung. Grundsätzlich muss aber jeder Verantwortliche dafür Sorge tragen, dass nur Trinkwasser bereitgestellt wird, welches den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht.
Was ist zu tun ?
Verantwortliche von Großanlagen müssen gemäß aktueller Trinkwasserverordnung ihre Trinkwasseranlage auf Legionellen untersuchen lassen.
Und zwar:
- gewerblich (z.B. Mehrfamilienhäuser) im Intervall von drei Jahren
- öffentliche (z.B. Hotels, Turnhallen, Kindergärten) im jährlichen Intervall (Intervall kann mit Absprache des Gesundheitsamtes verlängert werden)
- Einrichten von geeigneten Probenahmestellen mit geeigneten Probenahmeventilen
- Meldung der Anlage und der Ergebnisse bei Überschreitung des technischen Maßnahmenwertes bei Legionellen von 100 KBE/100ml
- Probenahme und Untersuchung durch ein zertifiziertes Unternehmen
Festlegung von geeigneten Probenahmestellen
Die Festlegung der repräsentativen Probenahmestellen hat ausschließlich durch kompetentes Personal zu erfolgen und kann auch im Rahmen der Hygiene-Erstinspektion durch den beauftragten Sachverständigen erfolgen. Die Festlegung der Probenahmestellen liegt in der Verantwortung des Betreibers und ist durch kompetentes Personal mit nachgewiesener Qualifikation zu treffen.
Einweisung des Betreibers
Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien Trinkwasserbeschaffenheit nach der Befüllung geht die Verantwortung für den bestimmungsgemäßen Betrieb der Trinkwasser-Installation auf den Betreiber über. Bis zum Vorliegen des Nachweises, längstens jedoch bis zum Zeitpunkt der werkvertraglichen Abnahme, hat der ausführende Installateur den bestimmungsgemäßen Betrieb sicherzustellen und zu dokumentieren.
Der Unternehmer und sonstige Inhaber (Betreiber) ist spätestens zu zum Zeitpunkt der Übergabe auf seine bestehenden Pflichten zum bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlage hinzuweisen, worüber ein Protokoll anzufertigen ist (Einweisung nach Kategorie C der VDI 6023). Bei der Einweisung des Betreibers in die Trinkwasser-Installation sollen potenzielle Gefahren im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene bei nicht bestimmungsgemäßem und nicht sachgerechtem Betrieb der Anlage erläutert werden.
Bei der Einweisung sind zudem die Funktionen, Bedeutungen und hygienisch erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen aller Komponenten der jeweiligen Trinkwasseranlage zu erläutern. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich die Übergabe einer vollständigen Dokumentation der zu betreibenden Trinkwasser-Installation. Auf dieser Grundlage ist ein schriftliches Einweisungsprotokoll anzufertigen, das der Unterwiesene durch Unterschrift bestätigt.
Die Durchführung der Einweisung obliegt dabei einem Fachmann, der mindestens nach Kat. A der VDI 6023 geschult ist.
Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.
